Was bedeutet Mentalisieren?
Der Mentalisierungsansatz ist eine innovative Theorie und betont die Fähigkeit, dem eigenen und dem Verhalten anderer eine Bedeutung zuzuschreiben, indem intentionale mentale Zustände (z.B. Emotionen, Wünsche oder Gedanken) unterstellt werden, die dem Verhalten zugrunde liegen.
Neuer Artikel Open-Access verfügbar: "Ich kann auch gut tanzen und habe es heute sogar vorgemacht." Mit Mentalisieren in der Psychomotoriktherapie einen Beziehungsraum für Gefühle der Zugehörigkeit eröffnen
Downloads
»Wer mentalisiert, versteht den anderen besser« - Mentalisieren als entwicklungsorientierte Professionalisierungsstrategie.
Downloads
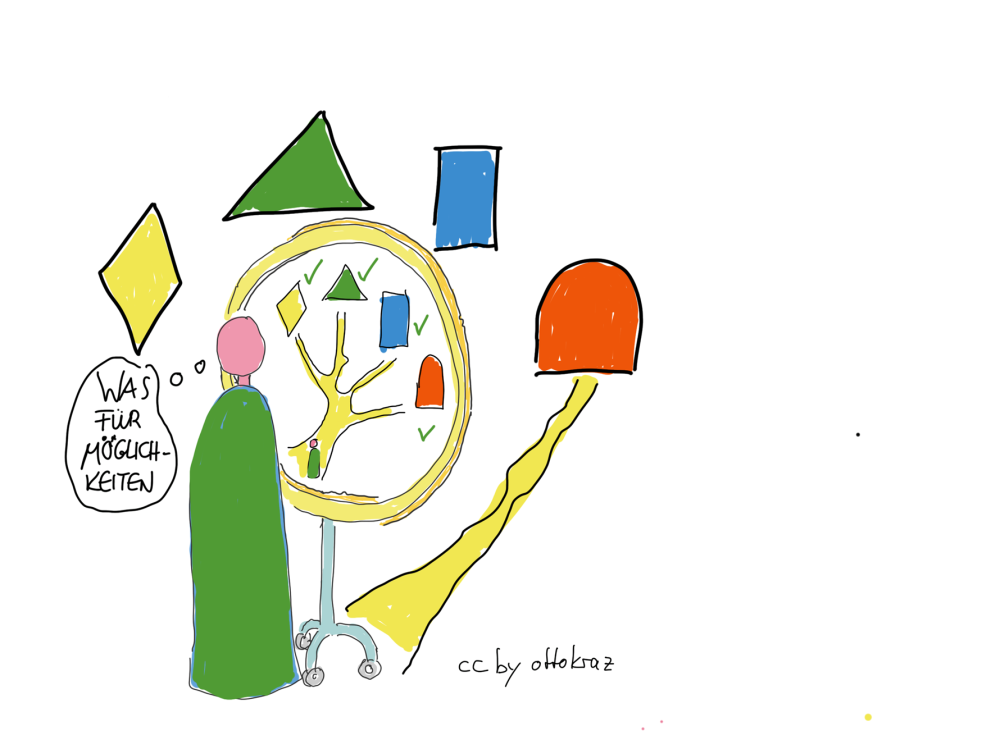
Folglich beschreibt Mentalisieren die Fähigkeit, Verhaltensweisen auf der Basis von Motiven (Gedanken und Gefühle, Wünsche, Absichten etc.) wahrnehmen und bedenken zu können – eigenes Verhalten sowie das Verhalten anderer Personen kann infolgedessen mit einer sinnstiftenden Intentionalität versehen werden, wodurch die Selbstkohärenz gestärkt wird und Verhaltensweisen verständlicher und vorhersehbarer werden (
Der heftige Schlag einer Person mit der Hand auf ein Autodach beispielsweise erscheint erst auf Basis eines mentalen Zustands als plausible Konsequenz – nämlich indem man Wut als mentalen Zustand annimmt (z.B. weil der Autoschlüssel im Inneren des Autos eingeschlossen ist).
Die Fähigkeit zu Mentalisieren entwickelt sich – beginnend in der Kindheit – entlang von Beziehungserfahrungen über die gesamte Lebensspanne hinweg. Sie ist eine Grundlage für die Entwicklung des Selbst und der Emotionsregulierung. Anhaltende oder schwere Kindheitsbelastungen (z.B. Traumata) können die Fähigkeit zu mentalisieren vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen. Unter erhöhtem emotionalem Arousal (Stress) ist es Menschen nur noch bedingt möglich, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen oder eine reflektierende Problemlösung zu verwirklichen.

Insbesondere im klinischen Feld wird die Fähigkeit zu mentalisieren als Schlüsselkompetenz angenommen und auch empirisch bestätigt (
Aus der Entwicklungspsychologie und der erfolgreichen Anwendung der Mentalisierungstheorie in Psychiatrie und Psychotherapie wurden neue grundlegende Kenntnisse zur Regulierung von Emotionen, von Aufmerksamkeit und Verhalten und über soziales Lernen erarbeitet. Diese finden zunehmend Eingang in pädagogische Felder, wie z.B. Mentalisierungsbasierte Pädagogik (

Was ist neu und wichtig am Mentalisierungsansatz?
- Ein Perspektivenwechsel von der Betrachtung der Handlung zu den Intentionen
- Dimensionen des effektiven und nicht-effektiven Mentalisierens
- Die Bedeutung von Stress und Emotionsregulierung
- Epistemisches Vertrauen und soziales Lernen
- Die Bedeutung reflektierender Prozesse und der Perspektivenübernahme
- Die Gestaltung hilfreicher Beziehungen
Dimensionen des Mentalisierens
Über verschiedene Entwicklungsschritte reift die Mentalisierungsfähigkeit (reflexiver Modus) in der frühen Kindheit heran. Der reflexive Modus versetzt das Individuum in die Lage verschiedene Pespektiven zu integrieren und sog. 'falsche Überzeugungen' zu erkennen.
Innerhalb des reflexiven Modus lassen sich vier Dimensionen mit jeweils zwei Polen unterscheiden (
a) Eine erste wichtige Unterscheidung erfolgt zwischen implizitem und explizitem Mentalisieren. Während sich implizites Mentalisieren auf automatische, zum Teil unbewusste und eher reflexartige Reaktionsweisen bezieht, ist letzteres durch eine kontrolliert reflektierende und damit bewusstere Haltung gekennzeichnet (meistens sprachlich kommuniziert). Die Fähigkeit zur reflexiven Betrachtung von Gefühlen oder Gedanken in der Beziehung kann bei emotionalem Stress zeitweise beeinträchtigt sein bis hin zum kompletten Zusammenbruch. Unter Stress oder großer Belastung dominiert das automatisch-implizite Mentalisieren.
b) Eine weitere Unterscheidung differenziert die Informationsquelle auf die sich Mentalisieren bezieht: Eine Fokussierung auf äußere Reize hilft, mentale Zustände zu verstehen (zum Beispiel, was sich vom Gesichtsausdruck oder von der Körperhaltung eines Gegenübers ableiten lässt), erfordert aber eine andere Mentalisierungsarbeit als solche Prozesse, die einen Fokus auf das Verstehen innerer Vorgänge legen (z.B. wie sich jemand gerade fühlt, was sein psychisches Innenleben ausmacht).
c) Die dritte Unterscheidung bildet eine Achse von kognitiven zu affektiven Prozessen. Beim Versuch zu erspüren (affektiv), welches Gefühl sich gerade in einer Person ausbreitet, werden andere (neuronale und psychische) Vorgänge rekrutiert als beim Nachdenken über Gefühle (kognitiv).
d) Ein letzter Aspekt der Mehrdimensionalität von Mentalisierung liegt in der Unterscheidung des Fokus auf das Selbst oder auf Andere. Manche Menschen können die Gefühle und Motive anderer sehr rasch einschätzen, können eigene Gefühle aber kaum wahrnehmen oder differenzieren. Bei anderen Menschen ist es genau umgekehrt. Entwicklungspsychologische und neurowissenschaftliche Erkenntnisse sprechen dafür, dass sich beide Fähigkeiten parallel und mit gegenseitiger Bezugnahme formieren (
Für die Beschreibung von Mentalisierungsprozessen ist diese Differenzierung in verschiedene Dimensionen hilfreich für die Beschreibung spezifischer Mentalisierungsstörungen oder für die Zielformulierung von Interventionen. Flexibles, sitationsangepasstes Mentalisieren gilt als zentral für effektives Mentalisieren.
Eine mentalisierende Haltung in der Praxis
Ausgehend von der Idee der Reflektionsfähigkeit als Entwicklungsziel lassen sich verschiedene Bausteine identifizieren, die mentalisierende Verstehensprozesse fördern. Diese Bausteine können vor allem in pädagogischen Handlungsfeldern als Orientierung verstanden werden, ob und wie sich Mentalisieren fördern lässt. Dabei ist Mentalisieren viel weniger eine hilfreiche Technik, als vielmehr eine grundsätzliche Haltung.
Mentalisierende Haltung
Eine mentalisierende Haltung ist zunächst geprägt von einer wohlwollenden, nichtwissenden Haltung und einer ruhigen Zugewandtheit und Flexibilität. Mentalisieren wird dann deutlich, wenn die Person nicht in ihren Anschauungen »feststeckt« und sich mit einem inneren Spielraum auf eigene und auf andere Perspektiven einlassen kann. Dieser Prozess kann dabei durchaus als spielerisch beschrieben werden, was sich z. B. in humorvoller Zugewandtheit ausdrücken kann.
Dies beinhaltet auch die Fähigkeit, Problemlösungen unter der Berücksichtigung verschiedener Perspektiven voranzubringen. Die Voraussetzung dafür bildet eine von Neugier geprägte Haltung - wir können nie genau wissen, was im Gegenüber vorgeht. Eine mentalisierende Haltung fördert sich für eigenes Verhalten verantwortlich zu fühlen und somit als Akteur der eigenen Handlungen wahrzunehmen. Das Ergebnis solcher Prozesse, sich selbst und anderen mentalisierend zu begegnen, hat wesentliche salutogenetische und resilienzfördernde Aspekte und fördert die psychischer Gesundheit (
Übertragen auf pädagogische Situationen bedeutet gelingendes Mentalisieren die sich stets wiederholende Haltung, »das Kind situativ, biographisch und entwicklungspsychologisch zu verorten« (
Die Bedeutung von Stress und Emotionsregulierung
Aus den bislang dargelegten Gedanken zum erfolgreichen Mentalisieren und zur Gestaltung entwicklungsfördernder Beziehungen im pädagogischen Kontext lässt sich erkennen, dass auch das Mentalisieren selbst einen passenden Rahmen benötigt. Insbesondere mit dem Erleben von Stress, Überforderung oder Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit kommt es zur Aktivierung des Bindungssystems, was in der Folge die Mentalisierungsfunktion einschränkt oder gänzlich zusammenbrechen lässt. Manchmal kommt es zu sogenannten nicht-mentalisierenden Kreisläufen, da es schwierig ist die eigene Mentalisierung aufrecht zu erhalten, wenn ein Gegenüber nicht mentalisiert.
Ausgehend von einem neurobiologischen Modell zur stressabhängingen Informationsverarbeitung im Gehirn (
Beispiel:
So mag es für eine Pädagogin vergleichsweise einfach sein gleichzeitig auf zwei untröstlich erscheinende Kinder beruhigend einzuwirken, weil sie auf innere Ressourcen zurückgreifen kann, die es ermöglichen, die Ursache für deren Kummer in einem gerade vorausgegangen Streit über ein Spielzeug zu sehen und sich dabei nicht in ihrem Selbstverständnis als Fachkraft bedroht zu fühlen. Eine andere Fachkraft mag jedoch ganz anders reagieren, zum Beispiel, indem sie sich von den beiden abwendet und sie sich selbst überlässt mit dem Gedanken, dass es auch ihr als Kleinkind geholfen habe, selbst aus einem solchen Gefühlszustand herauszukommmen. Dabei kann ihre eigene Erinnerung so belastend sein, dass sie sich nicht damit beschäftigen möchte und sich so auch nicht mit den Gefühlen der Kinder weiter beschäftigen möchte.
Wenn in beruflichen Alltagssituationen Gefühle von Entwertung, Ohnmacht oder Hilflosigkeit auftreten, kann es hilfreich sein wenn auch die Pädagogin einen Raum zur Reflektion erhält, in dem ihr mentalisierend begegnet wird. Zu denken wäre hier z. B. an spontane kollegiale Gespräche, Supervision oder Intervision.
Epistemisches Vertrauen und Soziales Lernen
Der Begriff epistemisches Vertrauens (EV) beschreibt ein basales Vertrauen in eine Person als sichere Informationsquelle. Ausgehend von
Schon früh entwickeln Säuglinge eine epistemische Wachsamkeit, indem sie unterscheiden von welchen Personen sie lernen möchten. Diese epistemische Wachsamkeit wird durch verschiedene Beziehungseinflüsse verringert (epistemisches Vertrauen, z.B. sichere Bindung) oder erhöht (epistemisches Misstrauen, z.B. bei Traumatisierung oder verletzenden und enttäuschenden Beziehungserfahrungen).
Macht ein Kind die Erfahrung, dass ihm mentalisierend begegnet wird, verbessert sich sein Verständnis davon, wie das Verhalten anderer motiviert ist. Das Gefühl, kontingent vom anderen wahrgenommen und mentalisiert zu werden, ist dabei das entscheidende Signal dafür, dass es ungefährlich ist, vom anderen zu lernen (
Bleibt das Verstehen des Gegenübers aus oder sind Interaktionen innerhalb einer Beziehung von dauerndem epistemischem Misstrauen geprägt (z. B. weil das Gegenüber als nicht-wohlmeinende, vernachlässigende, dauerhaft überstimulierende oder gar missbrauchende Person erlebt wird), so resultiert dies in sozialer Isolation und einer Verschlossenheit gegenüber anderen Menschen und potenziell relevante Informationen. Veränderungen oder Entwicklungen sind dann schwer möglich.
„Mentalisation is a slow and progressive process, perhaps the venture of a lifetime.“
Lecours & Bouchard 1997, Dimensions of Mentalisation. Int. J. Psycho-Anal. S. 865
Mentalisieren in der Pädagogik
Mentalisieren in der Pädagogik
Mentalisierung in der Pädagogik bedeutet die sozial-emotionale Entwicklung eines jungen Menschen aus dessen Perspektive zu betrachten, um pädagogische Interaktionen wie Erziehung, aber auch kognitive Lernprozesse über professionelle Haltungen und Interventionen daran auszurichten.
Das Verhalten des Kindes bzw. von Gruppen wird über das Verstehen mentaler Zustände und empirisches Entwicklungswissen interpretiert. Diese Reflexionen sind für Pädagoginnen und Pädagogen handlungsleitend. Das bedeutet, dass Mentalisieren letztlich als Form der angemessenen Reaktion innerhalb pädagogischer Interaktion zu verstehen ist.
Es handelt sich um einen vielversprechenden pädagogischen Zugang, der den Fokus auf Emotionen, Verstehen und Beziehung bzw. Bindung legt.
Die Mentalisierungstheorie steuert einen grundlegenden Beitrag zu einer zeitgemäßen reflexiven pädagogischen Beziehungstheorie bei. Sowohl für das kognitive Lernen, als auch für die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in pädagogischen Institutionen kann sie wichtige Erkenntnisse liefern.
Eine mentalisierungsbasierte Pädagogik unterliegt folgenden theoretischen Annahmen: Sie ist ein entwicklungsbezogener, verstehender und erklärender Ansatz, der auf der einen Seite aus der Sicht des jungen Menschen und den Gruppen, denen der junge Mensch zugehörig ist, pädagogische Interaktionen und Lernfelder erfühlt, begreift, denkt und entwicklungsförderlich gestaltet – also den jungen Menschen in seiner Entwicklung bedürfnisorientiert mentalisiert. Auf der anderen Seite rücken auch Pädagoginnen und Pädagogen in den Fokus, da sie durch Mentalisierung das eigene Handeln prüfen und auf die Bedürfnisse abstimmen, positiv auf Menschen einwirken, erziehen und bilden.
Der Ansatz der mentalisierungsbasierten Pädagogik ist demnach intersubjektiv und interaktionistisch. Dabei spielen sowohl individuelle situative und biographische (z.B. konflikthafte/potentiell traumatische) Faktoren als auch empirisch-entwicklungspsychologische Annahmen über junge Menschen bzw. Gruppen neben didaktisch-methodischen Befunden eine Rolle. Auch die subjektive Bedeutung der/s Pädagogin/en für die Interaktionen wird in die Reflexion mit einbezogen. Die professionelle Beziehungsgestaltung zwischen der/m Pädagogin/en und dem jungen Menschen ist dabei sowohl zwischenmenschliches Bindeglied als auch Ergebnis der Erkenntnisbemühungen.
Ziel ist es, über Anerkennung der Stärken, Ressourcen und der individuellen/gruppenbezogenen Entwicklungsbedürfnisse des Kindes einen Raum anzubieten, in dem Angst bewältigt und so ein epistemisches Vertrauen als Grundlage für die Lernfähigkeit und den Umgang mit (Entwicklungs-)Konflikten (wieder) hergestellt werden kann.
Dies ist als ein präventiver und vor allem aber interventiver Beitrag der Pädagogik zu Lernfähigkeit, mentaler Gesundheit und damit zu psychischer Widerstandsfähigkeit (Resilienz) von Kindern und Jugendlichen sowohl in Schule, elementar-, sozial-, intensiv- und erwachsenenpädagogischen Bereichen zu betrachten. Je jünger und je belasteter die Kinder und Jugendlichen sind, desto stärker muss dies in die alltägliche Interaktion als Primärerfahrung oder sekundären Alternativerfahrungen und deren Reflexion einbezogen werden. In diesem Sinne wird der interpersonale Raum zwischen Kind und Pädagogin/en als von bisherigen Beziehungskontingenzen und Bindungserfahrungen geprägt betrachtet. Gleichzeitig stellt dieser Raum ein „window of opportunity” mit Entwicklungspotential dar, wenn es gelingt, das Kind im Kontext von Erziehung und Wissensvermittlung als intentionales Individuum zu mentalisieren.
Wozu braucht es Mentalisieren in der Sozialen Arbeit?
Gegenstand Sozialer Arbeit sind Entstehungsprozesse sozialer Ausschließung und deren soziale, gesundheitliche und psychische Auswirkungen. Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit fördert Gesundheit als wesentlichen Bestandteil des alltäglichen Lebens.
Beispiel 1: Erwachsene in prekären Lebenssituationen
Spangenberg (1996) spricht von Illusionärer Verkennung in der Sozialen Arbeit, denn weder finanzielle Unterstützung alleine, noch (psychotherapeutische) Bearbeitung der lebensgeschichtlichen Belastungen reichen aus, um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Erst durch die Bereitstellung von Ressourcen, einer Förderung von Reflektion und Perspektivenübernahme (z.B. durch Unterstützung in der Stressverarbeitung, Mentalisierung), werden Empowerment, Lebensweltorientierung oder Hilfe zur Lebensbewältigung gefördert. Das Ergebnis solcher Prozesse, sich selbst und andere mentalisierend zu verstehen, hat wesentliche gesundheitsfördernde, salutogenetische, also resilienzfördernde Aspekte.
Beispiel 2: Soziale Arbeit findet in Institutionen statt
Durch die Arbeit der Institutionen entstehen strukturelle Widersprüche (Thiersch & Böhnisch, 2014) zwischen der Passung von institutionellen Unterstützungsangeboten einerseits und persönlicher Lebenswirklichkeit/Notlage, z.B. Wohnungslosenhilfe - Drogenhilfe – Gemeindepsychiatrie – Kinder- und Jugendhilfe, andererseits.
Für gelingende Unterstützungsprozesse braucht die Institution die Bereitschaft, die Perspektive der individuellen Lebenswirklichkeiten der Adressaten/innen zu übernehmen, gleichzeitig fordert es von den Adressaten und Adressatinnen die Perspektive der Institutionen und professionellen Mitarbeiter mitzudenken. Dazu braucht es Einfühlungsvermögen und Perspektivenübernahme, also Mentalisierung sowie Unterstützung bei der Stress- und Emotionsregulation auf beiden Seiten.
Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit
- Trägt zur gesellschaftlichen Teilhabe, Ressourcenförderung, Netzwerkbildung und Gesundheitsförderung bei.
- Fördert die Entwicklung von Kompetenzen zur Stressbewältigung und Problemlösung.
- Mentalisierung als Hilfe zur Lebensbewältigung ist wissenschaftlich begründet, entwicklungsorientiert und bezieht Umweltbedingungen mit ein.
Was bedeutet Mentalisieren für die Kinder- und Jugendhilfe
Mentalisieren gilt allgemein als ein Schlüsselbegriff psychischer Gesundheit und Widerstandsfähigkeit (
Es kann angenommen werden, dass sich mentalisierungshemmende Interaktionen zwischen den Fachkräften und den Kindern und Jugendlichen manifestieren, sofern diese nicht aktiv reflektiert und verarbeitet werden können. Die Folgen können weitreichend bis hin zu einem Abbruch der Maßnahme aufgrund von unreflektierten bzw. ausagierenden Reaktionen sein. Dies wiederum sind Muster, die den Kindern und Jugendlichen wohl bekannt sind und die sie in ihrem oftmals traumatischen Beziehungserleben und ihren Reaktionen bestärken. All diese Gründe sprechen dafür, Mentalisierungsprozesse innerhalb des pädagogischen Alltags, innerhalb des Teams und auch individuell selbstreflexiv in den Blick zu nehmen. Gelingende Mentalisierungsprozesse aufseiten der Fachkräfte ermöglichen dabei, die interpersonelle Reziprozität von herausfordernden Interaktionsverläufen zu erkennen und den jungen Menschen die Erfahrung anzubieten, dass sie mentalisiert werden und ihr Verhalten für andere und auch für sich selbst verstehbar sein kann. Neben dem Erkennen von mentalisierungshemmenden Dynamiken verspricht eine mentalisierende Haltung schließlich das Aushalten und Fördern von Beziehungserfahrungen zwischen den jungen Menschen und den Fachkräften (
Fachkräfte in Einrichtungen der Frühen Bildung und Betreuung nehmen eine wichtige Funktion in der Entwicklung der kindlichen Mentalisierungsfähigkeit ein. Angesichts der Sensibilisierung für intersubjektive Fachkraft-Kind-Prozesse in der Frühpädagogik, ist den psychisch-mentalen Kapazitäten von Fachkräften künftig gezielte Aufmerksamkeit zu schenken. Das Mentalisierungskonzept könnte sich hierbei als fruchtbares Modell erweisen, um auf Kind- und Fachkraftebene für bindungs- und bildungsrelevante Schlüsselsituationen zu sensibilisieren. Beispielsweise ist anzunehmen, dass robuste Mentalisierungsfähigkeiten auf Seiten der Fachkraft unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung pädagogischer Alltagsinteraktionen ausüben, indem insbesondere stressintensive Ereignisse (z.B. im Rahmen der Eingewöhnung) für Fachkräfte reflexiv zugänglich sind und in der Folge angemessene, feinfühlige Reaktionen auf die Äußerungen des Kindes ermöglichen.
Nicht zuletzt kann die Mentalisierungsfähigkeit der Fachkräfte zu einer differenzierteren Wahrnehmung eigener Befindlichkeiten beitragen, indem sie mentalisierende Verstehensprozesse von stressauslösenden Situationen fördern, die zur Gesunderhaltung der Fachkraft selbst und langfristig zur Verminderung der Personalfluktuation (z.B. in Kitas mit verdichteten sozialen Problemlagen) beitragen.
Für die Arbeit in pädagogischen Teams
Mentalisieren in pädagogischen Teams versucht das Team als elementares Teilsystem einer pädagogischen Institution zu verstehen, in der sich das einzelne Kind bzw. die Gruppe von Kindern:
a) situativ,
b) biografisch,
c) entwicklungspsychologisch und
d) sozio-kulturell
e) in der pädagogischen Institution verorten lässt.
Erst die Berücksichtigung der mentalen Zuständen des Kindes (und der Interaktion mit seinem Familiensystem) kann Mentalisieren ermöglichen um bewusst adäquate pädagogische Haltungen und Interventionen abzuleiten. Das bedeutet für die alltägliche pädagogische Arbeit, dass die pädagogische Arbeit nicht nur mit dem Kind bzw. den Kindern stattfindet, sondern, dass auch die Art und Qualität der Reflexion im Team (z.B. Supervision, Fallberatung, Intervision usw.) bedacht werden muss. Dies muss strukturell als Arbeitszeit für das gesamte Team eingeplant werden. Es ist somit kein freiwilliges Angebot, sondern elementarer Teil der jeweiligen Dienstverpflichtung.
Für die Arbeit in Schulen
Schulpädagogische Interaktionsprozesse können für Lehrpersonen als auch für Lernende als belastende Situationen erlebt werden, die beispielsweise die Lehr- und Lernmotivation sinken lässt, Missinterpretationen sowie intra- und interpersonelle Konflikte hervorrufen können. Mit Berücksichtigung emotionaler Aspekte des Lernens und Lehrens ist bekannt, dass die Qualität der Wahrnehmung der Erziehungs- und Bildungsaufgaben davon abhängt, in welcher Form Lehrerinnen und Lehrer die mentalen Zustände, sowie die bewussten und unbewussten Motive, Ängste und inneren Konflikte bei sich und bei ihren Schülerinnen und Schülern verstehen und darauf aufbauend den Unterricht gestalten können.
Insbesondere in emotional belastenden Situationen ist es für Pädagog*innen schwierig, den Blick auf das aktuelle interaktive Geschehen, auf die eigenen mentalen Zustände und die des Gegenübers zu lenken. Da die Mentalisierungsfähigkeit keine statisch erworbene Fähigkeit ist, kann es speziell in psychischen Stress- und Belastungssituationen zu einem erhöhten intrapersonellen Arousal kommen (vgl.
Das bewusste Wahrnehmen emotionaler Aspekte und ihrer Bedeutung kann als schwer aushaltbar erlebt und abgewehrt werden. Es kann zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen führen, die in weiterer Folge den professionellen Handlungsspielraum einschränken und die Interaktion mit dem Gegenüber beeinflussen. So fühlt sich beispielsweise eine Pädagogin in der Interaktion mit einem Kind plötzlich wie gelähmt und kann das tobende oder weinende Kind weder trösten noch beruhigen. Der mentale Raum der Pädagogin fällt in diesem Moment in sich zusammen und lässt sie für einen Moment handlungsunfähig erscheinen. Gelingt es in der belastenden Situation, den mentalen Raum möglichst rasch wiederherzustellen, so kann eine haltende und pädagogisch hilfreiche Beziehung aufrechterhalten werden.
Das Mentalisieren von Beziehungen ist in der Lehrerausbildung und -weiterbildung noch einen wenig berücksichtigter Themenkomplex. Diesbezüglich erschließt sich im Speziellen für das Erlernen, Reflektieren und Anwenden von psychodynamischen Prozessen in der pädagogischen Praxis ein wichtiges Forschungs- und Entwicklungsdesiderat.
Mentalisieren und psychische Gesundheit

In jüngerer Vergangenheit wird verstärkt auf die potentiell gesundheitserhaltende Funktion mentalisierender Verstehensprozesse fokussiert (z.B.

